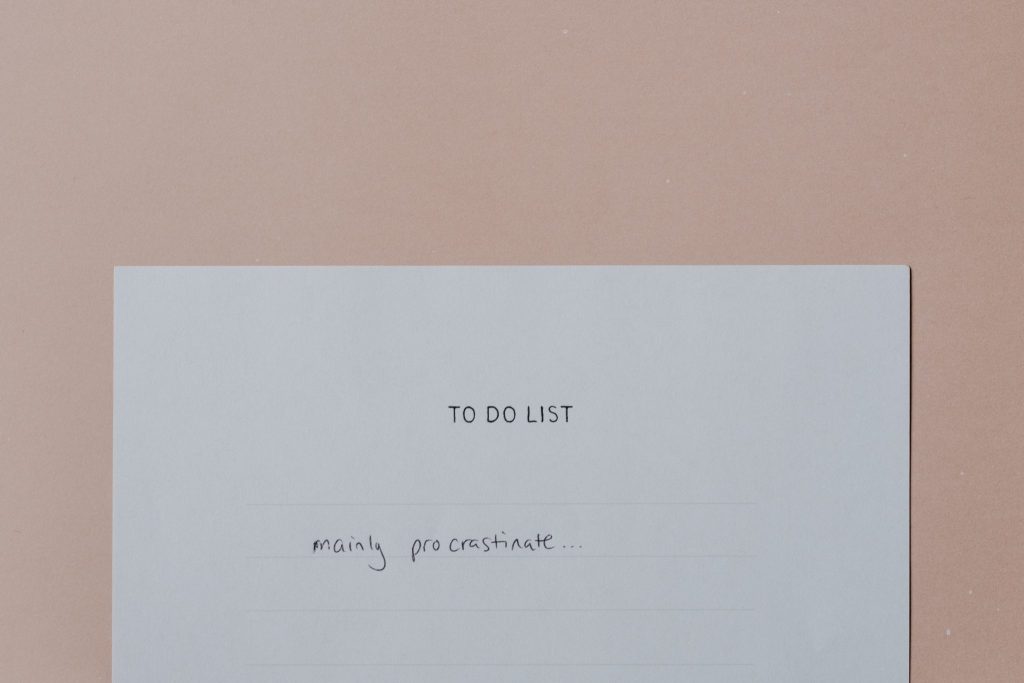Alltagsneurose oder Zwangserkrankung
Wer kennt diese Fragen nicht? Die Fahrt in den Urlaub kann starten und es schießt die Frage in den Kopf: Habe ich das Bügeleisen ausgemacht? Ist die Terrassentür zu? Und zur Sicherheit läuft man ins Haus zurück, um festzustellen: Alles in Ordnung! In den meisten Fällen, fällt dieses Verhalten in den Bereich Alltagsneurosen und muss nicht weiter behandelt werden. Doch wo verläuft die Grenze zu einer Zwangserkrankung, die behandlungswürdig ist? Die Grenzen können fließend sein. Ein entscheidendes Kriterium ist der Leidensdruck der betroffenen Person und die Einschränkungen im Alltag sowie die Verringerung der Lebensqualität.
Zwang & Angst
Eine Zwangserkrankung ist eine Art von Angststörung, bei der eine Person ständig wiederkehrende, unerwünschte Verhaltensweisen, Gedanken oder Impulse hat, die dazu dienen, die Angst und Anspannung zu reduzieren. Die Betroffenen befürchten häufig, dass ihnen oder anderen Menschen in ihrem Umfeld etwas Schlimmes zustoßen könnte, wenn sie den Zwangsimpulsen nicht nachkommen. Manche Betroffenen leiden beim Unterlassen der Zwangshandlungen auch unter einem quälenden Eindruck, dass die Handlung oder Erfahrung nicht „genau richtig“ ist. Das Erscheinungsbild von Zwangssymptomen ist sehr vielseitig und kann sehr unterschiedlich aussehen.
Zwangshandlungen
Als Zwangshandlungen versteht man Verhaltensweisen, zu denen sich die Betroffenen gezwungen fühlen, obwohl sie dies selbst als unsinnig und übertrieben bewerten. Die Handlung dient zur Reduktion von Ängsten oder dazu, den Eintritt eines gefürchteten Ereignisses zu verhindern. Ein Beispiel für Zwangshandlungen könnte sein, dass eine Person immer wieder ihre Hände waschen muss, um sich und andere vor einer Infektion zu schützen. Diese Handlungen können sehr zeitaufwendig sein und das tägliche Leben der Person stark beeinträchtigen.
Zwangsgedanken
Zwangsgedanken sind sich wiederholende, sich aufdrängende Gedanken oder Vorstellungen. Die Betroffenen haben den Eindruck, die Gedanken nicht stoppen zu können und ihnen ausgeliefert zu sein, obwohl sie ihnen als unsinnig und fremd erscheinen. Zu einer Ausführung der Handlung kommt es in der Regel nicht. Im Gegenteil, sie erleben oft starke Angst und Unbehagen in Bezug auf ihre Zwangsgedanken und versuchen, diese zu bekämpfen oder zu kontrollieren. Dies kann zu zwanghaften Handlungen oder Ritualen führen, die zum Neutralisieren dienen sollen, um die Ängste zu lindern, die mit den Zwangsgedanken einhergehen.
Therapie Zwangserkrankungen
Die Betroffenen einer Zwangserkrankung haben keine Kontrolle über ihre Zwangshandlungen oder -impluse und können nicht einfach entscheiden, damit aufzuhören. Dagegen Widerstand zu leisten oder sie zu ignorieren ist kaum möglich. Umso wichtiger ist es, sich professionelle Hilfe zu suchen, wenn man vermutet, unter einer Zwangserkrankung zu leiden. Hier gilt: Je früher, desto besser.
Die integrative kognitive Verhaltenstherapie hat sich bei der Behandlung von Zwangsstörungen als hilfreich erwiesen. In einer Therapie gilt es zunächst zu verstehen, was die Betroffenen konkret befürchten, wenn sie ihren Zwangsimpulsen nicht nachkommen. Befürchten sie zum Beispiel an einer Infektion zu sterben, wenn sie dem Impuls, sich die Hände zu waschen nicht nachkommen, könnte die existenzielle Angst zu sterben eine Ursache für die Zwangshandlung sein. Eine andere Befürchtung könnte sein, andere Menschen zu infizieren und dann ein schlechter bzw. wertloser Mensch zu sein. In diesem Fall könnte die Ursache ein Selbstwertproblem sein. Entsprechend unterschiedlich sind die Therapieansätze bei der Behandlung von Zwangssymptomen.
Fragen dazu beantworte ich gerne in einem Erstgespräch.